Metternich-Winneburg Klemens Wenzel Lothar Fürst, Staatsmann. * Koblenz (Rheinland-Pfalz), 15. 5. 1773; † Wien, 11. 6. 1859. Aus rhein. Gf.Geschlecht, Vater des Folgenden, Großvater und Schwiegervater der Vorigen; stud. an den Univ. Straßburg und Mainz, wo er von Vogt (Gleichgewichtslehre) und Burke beeinflußt wurde. Von der Französ. Revolution stark beeindruckt, flüchtete er nach Österr., wo er 1795 die Enkelin des Staatskanzlers Kaunitz, Maria Eleonora, heiratete, wodurch er in die österr. Diplomatie und Ges. hineinwuchs. 1801 Gesandter in Dresden, 1803 in Berlin, 1806 Botschafter in Paris, 1809 Staatsmin., 1821 Staatskanzler. Als Virtuose der diplomat. Technik gelang es ihm, eine Koalition gegen Napoleon I. zustande zu bringen, dessen Vermählung mit der Kaisertochter Maria Louise (s. d.) er befürwortet hatte. Auf dem Wr. Kongreß erreichte M. als „Kutscher Europas“ den Höhepunkt seiner Erfolge. Es gelang ihm dort, die Grundlagen für ein neues Europa zu schaffen und damit für mehrere Jahrzehnte dessen Stabilität zu sichern. M., dessen „System“ in festen, im Zeitalter der Aufklärung wurzelnden sozial-philosoph. Anschauungen verankert war, suchte auf und nach dem Wr. Kongreß die Prinzipien des Gleichgewichtes der Großmächte, der Legitimität sowie einer polit.-sozialen Beharrung zur Geltung zu bringen. Dem Josefinismus stand er im Grunde ferne, widersetzte sich daher auch dem Abbau des Staatskirchentums nicht. Verschiedene Gruppen der Bürokratie und seiner adeligen Standesgenossen, die ihn als „Zuwanderer“ ansahen, standen ihm ablehnend gegenüber. Seine Ziele entsprachen aber durchaus der österr. Staatsräson und waren nur mittelbar an europ. Gesichtspunkten orientiert. Sein Widerspruch zu den Tendenzen des Zeitgeistes prägte sich in seiner Interventionspolitik gegen alle Ansätze zur Verwirklichung der Idee der Volkssouveränität aus, was weiterhin nicht nur zur Bekämpfung aller revolutionären, sondern überhaupt aller liberaler Bestrebungen führte. M., der 1817 die „Heilige Allianz“ geschaffen hatte und später immer wieder eine Anlehnung an Rußland suchte, geriet dadurch in einen außenpolit. Gegensatz zu England, das seine Italienpolitik störte und seiner Tendenz, die Machtstellung der Türkei zu erhalten, entgegenwirkte. Nach dem Tod K. Franz I. (s. d.) wurde seine Position, die er aber noch 13 Jahre, bis zum Ausbruch der Märzrevolution, zu behaupten verstand, auch innenpolit. immer schwächer. In der Führung der Außenpolitik wurde M. zusehens unbeweglicher, im Innern trat sein Gegensatz zu Gf. Kolowrat (s. d.) immer schärfer hervor. Als sein System durch die Revolution gestürzt wurde, hatte er sich im Grunde selbst schon überlebt. M. mußte zwar nach Brüssel und London fliehen, sein Einfluß auf die maßgebenden Kreise in Österr. erfuhr aber kaum eine Unterbrechung. Ab 1851 hielt er sich wieder in Wien auf. In den folgenden Jahren ist seine Einwirkung auf den jungen K., F. Schwarzenberg und andere Staatsmänner deutlich zu erkennen. Auf Gebieten, die ihm polit. nicht gefährlich erschienen, war M. ein Förderer des Fortschritts, vor allem im Bereich der Naturwiss. und der Wirtschaft. Sein Bild in der Historiographie, das oft genug verzeichnet, dann in der umfassenden Biographie von Srbik allzusehr aufgehellt wurde, scheint sich gegenwärtig in der in- und ausländ. Forschung auf eine Mittellage einzupendeln. M. war in zweiter Ehe mit Antoinette Freiin v. Leykam (1825), in dritter Ehe mit Melanie Gfn. Zichy-Ferraris (1827) verheiratet, hatte aber daneben zahlreiche illegitime Verhältnisse, die häufig im Dienst der Politik standen oder auf diese zurückwirkten.
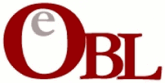
Austrian Centre for Digital Humanities and Cultural Heritage
Österreichisches Biographisches Lexikon |

 © Bildarchiv Austria, ÖNB
© Bildarchiv Austria, ÖNB © Bildarchiv Austria, ÖNB
© Bildarchiv Austria, ÖNB