Scherer Wilhelm, Germanist. * Schloß Schönborn b. Göllersdorf (NÖ), 26. 4. 1841; † Berlin-Grünau, 6. 8. 1886. Sohn eines gräflichen Oberamtmannes, Vater der Krankenpflegerin Marie S. (s. d.); absolv. das Akadem. Gymn. in Wien, wo er bes. durch seinen Lehrer K. Reichel für großdt. bzw. nationalliberale Ideen begeistert wurde; stud. ab 1858 zunächst drei Semester Germanistik, klass. Philol. und vergleichende Sprachwiss. an der Univ. Wien u. a. bei F. Pfeiffer, Bonitz, Miklosich (alle s. d.) und Vahlen. Von Pfeiffers antipreuß. akzentuierter Opposition gegen die „Lachmannschule“ enttäuscht, ging S. 1860 in deren Zentrum Berlin, um an der dortigen Univ. J. Grimm, M. Haupt, F. Bopp und L. v. Ranke zu hören, bes. aber, um bei K. Müllenhoff „Methode“ zu lernen. Dieser lud S. 1862 zur Mitarbeit an seinen „Denkmälern deutscher Poesie und Prosa aus dem VIII.–XII. Jahrhundert“ (1864, mehrfach aufgelegt) ein und übertrug ihm darin die Edition einiger poet. und sämtlicher Prosatexte. In virtuoser Verbindung von krit. Texterstellung und inhaltlicher Erschließung unter hist., jurid. und theolog. Aspekten schuf S. damit sein lange als philolog. Musterarbeit geltendes Erstlingswerk. Nach der Prom. in Wien (1862) wurde S.s mit dem Manuskript der „Denkmäler“ angestrebte Habil. von Pfeiffer 1863 zunächst abgelehnt und 1864 von der Fak. auf die Venia für got., alt- und mittelhochdt. Grammatik und für Erklärung alt- und mittelhochdt. Sprachdenkmäler eingeschränkt. Auch der Versuch einer Erweiterung auf das Gesamtgebiet der dt. Philol. mit der Monographie über Jakob Grimm führte erst nach Rekurs ans Min. 1866 zum Erfolg. Nach Pfeiffers Tod 1868 zu dessen Nachfolger als o. Prof. bestellt, krönte S. seine Wr. Zeit mit seinem Werk zur Geschichte der deutschen Sprache, das eine positivist. Erklärung der Sprachentwicklung durch analoge Projektionen des gegenwärtigen, physiolog. determinierten sprachlichen Normensystems auf vergangene Sprachzustände zu leisten versuchte. Mit dieser kausalen Verbindung von Phonetik und Lautgeschichte hob er sich trotz Festhaltens am national-eth. Überbau doch deutlich von Grimms Lehre ab und wirkte anregend auf die Theorien der späteren „Junggrammatiker“. Häufige Kontroversen mit den Behörden wegen propreuß. Agitation im Lehrbetrieb und bei akadem. Burschenschaften ließen S. 1872 einen Ruf als o. Prof. nach Straßburg annehmen. Hier vollzog sich mit dem Interesse an bedeutsamen regionalen Autoren auch seine entscheidende Wende zur neueren Literaturgeschichte: Dem noch in Wien gem. mit Lorenz (s. d.) begonnenen (auch literar. hist.) Überblick zur „Geschichte des Elsasses . . .“ (1871) folgten Arbeiten zu Jörg Wickram, zu Dramatikern und Prosaisten des 16. und 17. Jhs. und zum jungen Goethe. Durch Gründung eines der ersten germanist. Seminare im dt. Sprachraum sicherte er die gleichrangige Ausbildung der Studierenden in der traditionellen älteren dt. Philol. und in der neueren Literaturgeschichte. Mit den „Quellen und Forschungen zur Sprach- und Culturgeschichte der germanischen Völker“ (1874ff.) schuf er dazu eine auch seinen Schülern offenstehende Publ.Reihe. Eine auf Müllenhoffs Anregung schon 1872 in Straßburg geplante literar. hist. Gesamtdarstellung konnte S. erst realisieren, als er 1877 das für ihn neuerrichtete Ordinariat in Berlin übernahm. Die „Geschichte der deutschen Litteratur“ (ab 1880) sollte breiteren Kreisen die „innere Entwicklung der deutschen Nation“ vermitteln. Sie konzentriert sich, z. Tl. nach Gervinus’ Vorbild, auf kanonisierte Autoren und sucht, z. Tl. gestützt auf die Milieutheorie Taines, deren Werke als Resultat der Determinanten „Ererbtes, Erlerntes, Erlebtes“ zu erklären. Wiederum unter Einsatz von Vergleichs- und Analogieaspekten wird die literar. Gesamtentwicklung als naturgesetzliche „Wellenbewegung“ begriffen, in der, beginnend mit 600 n. Chr., je 300jährige alternierende Phasen von Höhe- und Tiefpunkten aufeinander folgen. Trotz dieser schon damals umstrittenen Periodisierung galt die „Literaturgeschichte“ in ihrer method. Verbindung von romant. Germanistentradition mit „modernem“ Positivismus bis in die 20er Jahre als Standardwerk und wurde daher 1917 von O. Walzel bis zum Beginn des 20. Jh. fortgesetzt. Unter den kleineren Arbeiten der Berliner Zeit, etwa Beitrr. für ADB, zu Goethe, aber auch zu zeitgenöss. Literaten, ragt bes. S.s Antrittsrede vor der Berliner Akad. der Wiss. heraus, die sein bisheriges Forschungsprogramm umreißt und neue Ziele absteckt. Die geplante, auf einer „empirischen historisch-psychologischenÄsthetik“ aufbauende „Poetik“ kam allerdings wegen S.s frühem Tod nicht mehr zur Ausführung und wurde aus Materialien und Entwürfen von R. M. Meyer (1888) ediert. S. war einer der letzten, die das Gesamtgebiet der Germanistik ausgewogen beherrschten, zugleich aber einer der ersten, die die „Neugermanistik“ im Lehr- und Forschungsbetrieb fest verankerten. Seine positivist. Methode wurde bes. auf literarhist. und biograph. Gebiet schulebildend; bis in die 20er Jahre dieses Jhs. waren alle bedeutenden germanist. Lehrstühle von seinen Schülern besetzt (z.B. K. Burdach, R. M. Meyer, Minor, s. d., A. Sauer, s. d., J. Seemüller, E. Schmidt, E. Schröder). Aber auch nach der allmählichen Ablösung der positivist. Methode durch die geistesgeschichtliche bzw. stilist. Literaturbetrachtung wirkten seine Arbeiten auf diese gerade ex negativo anregend. S. war korr. Mitgl. der Akad. der Wiss. in Wien (1869) und Mitgl. der Akad. der Wiss. in Berlin (1884).
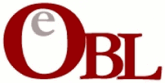
Austrian Centre for Digital Humanities and Cultural Heritage
Österreichisches Biographisches Lexikon |

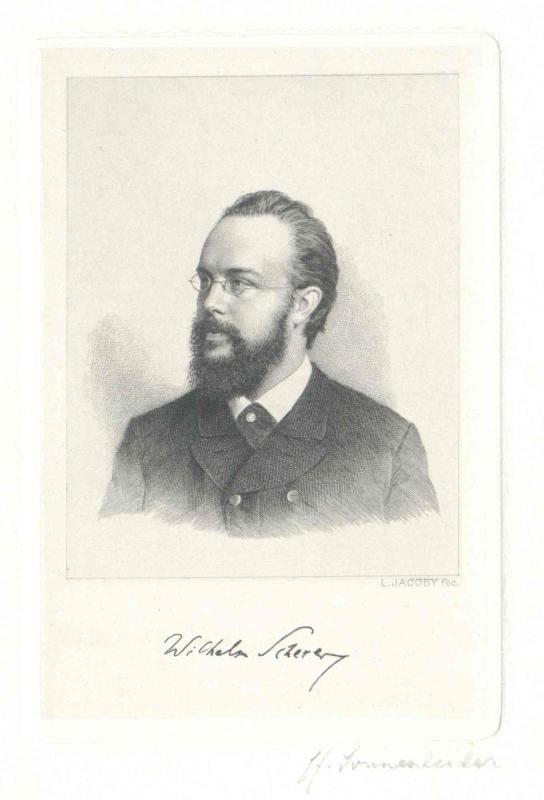 © Bildarchiv Austria, ÖNB
© Bildarchiv Austria, ÖNB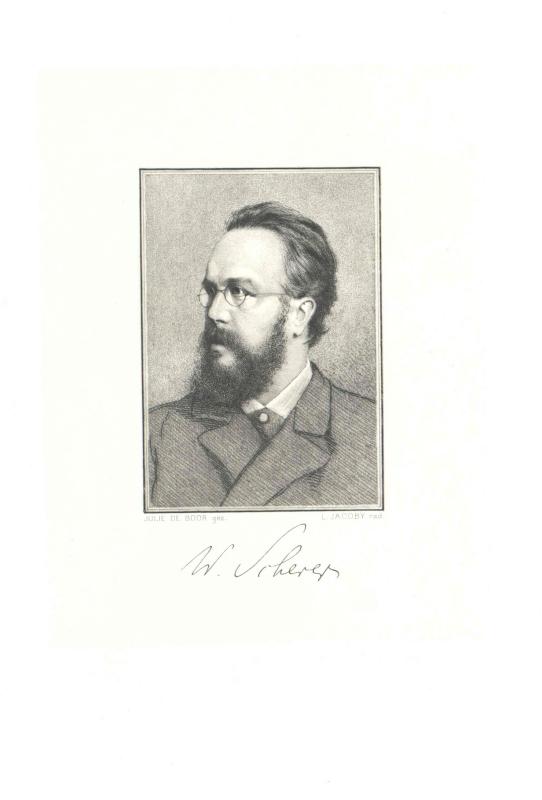 © Bildarchiv Austria, ÖNB
© Bildarchiv Austria, ÖNB