Unger Joseph (Josef), Jurist und Politiker. Geb. Wien, 2. 7. 1828; gest. ebd., 2. 5. 1913; mos., ab 1852 röm.-kath. Sohn des aus Körmend stammenden jüd. Kaufmanns Martin U. und dessen Gattin Flora U., geb. Porias; verheiratet mit Emma U., der Tochter von →Friedrich Frh. Schey v. Koromla. – U. besuchte das Akadem. Gymn. in Wien, stud. anschließend Phil. (1845–47) und Rechtswiss. (1847–51) an der Wr. Univ. und am Theresianum. Aufgrund einer Arbeit über „Die Ehe in ihrer welthistorischen Entwicklung“ wurde er 1850 an der Univ. Königsberg in absentia zum Dr. phil. prom.; 1852 Prom. zum Dr. iur. an der Univ. Wien; 1853 Habil. ebd. mit einer rechtsvergleichenden Untersuchung („Der Entwurf eines bürgerlichen Gesetzbuches für das Königreich Sachsen mit besonderer Rücksicht auf das österreichische allgemeine bürgerliche Gesetzbuch besprochen ...“); im selben Jahr ao. Prof. des allg. bürgerl. Gesetzbuchs an der Univ. Prag. Unterrichtsminister →Leo Gf. v. Thun u. Hohenstein, der eine umfassende Univ.- und Stud.reform in die Wege geleitet hatte, fand in U. einen höchst bedeutenden Helfer. In U.s Antrittsvorlesung in Prag 1853 „Ueber die wissenschaftliche Behandlung des österreichischen gemeinen Privatrechts“ erfolgte eine deutl. Absage an die exeget. Schule. In der Abh. „Ueber den Entwicklungsgang der österreichischen Civiljurisprudenz seit der Einführung des allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuchs“ (in: Jbb. der dt. Rechtswiss. und Gesetzgebung 1, 1855) wurde die Hinwendung zur hist.-systemat. Methode der dt. Pandektenwiss. stärker betont. Das Allg. bürgerl. Gesetzbuch (ABGB) sollte so wie das Allg. Landrecht für die preuß. Staaten nach den Grundsätzen der hist. Schule und der Pandektenwiss. behandelt und interpretiert werden. 1856 wurde U. zum ao. Prof., 1857 zum o. Prof. des österr. Zivilrechts an der Univ. Wien ernannt. Er verf. ein grundlegendes „System des österreichischen allgemeinen Privatrechtes“ (Bde. 1–2, 1856–59, von beiden 5. Aufl. 1892; Bd. 6: Das österr. Erbrecht, 1864, 4. Aufl. 1894). 1859 begann er mit dem Strafrechtler →Julius Glaser die Hrsg. einer „Sammlung von civilrechtlichen Entscheidungen des k. k. obersten Gerichtshofes“. Ab den 1860er-Jahren wandte sich U. der Politik zu, in der er das liberale Bürgertum vertrat: 1867 Abg. im nö. LT, im selben Jahr Mitgl. des AH des RR, 1869 Mitgl. des HH auf Lebenszeit; 1871–79 Sprechminister (Minister ohne Portefeuille). Seine größte Leistung als Minister war die Schaffung des Verwaltungsgerichtshofs (1875). Im Jänner 1881 wurde U. Präs. des österr. Reichsgerichts. Während er sich zunächst (1855) für eine Totalrevision des ABGB im pandektist. Sinne ausgesprochen hatte, trat er 1904 nur mehr für eine Teilnovellierung ein. U. gilt neben Karl Anton v. Martini und Franz v. Zeiller als der einflussreichste österr. Zivilrechtler der Monarchie. Zahlreiche Ehrungen wurden ihm zuteil, u. a. 1873 Geh. Rat, österr.-ung. Ehrenzeichen für Kunst und Wiss., 1879 Großkreuz des Leopold-Ordens, 1894 Ehrenmitgl. der k. Akad. der Wiss. in Wien.
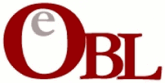
Austrian Centre for Digital Humanities and Cultural Heritage
Österreichisches Biographisches Lexikon |
